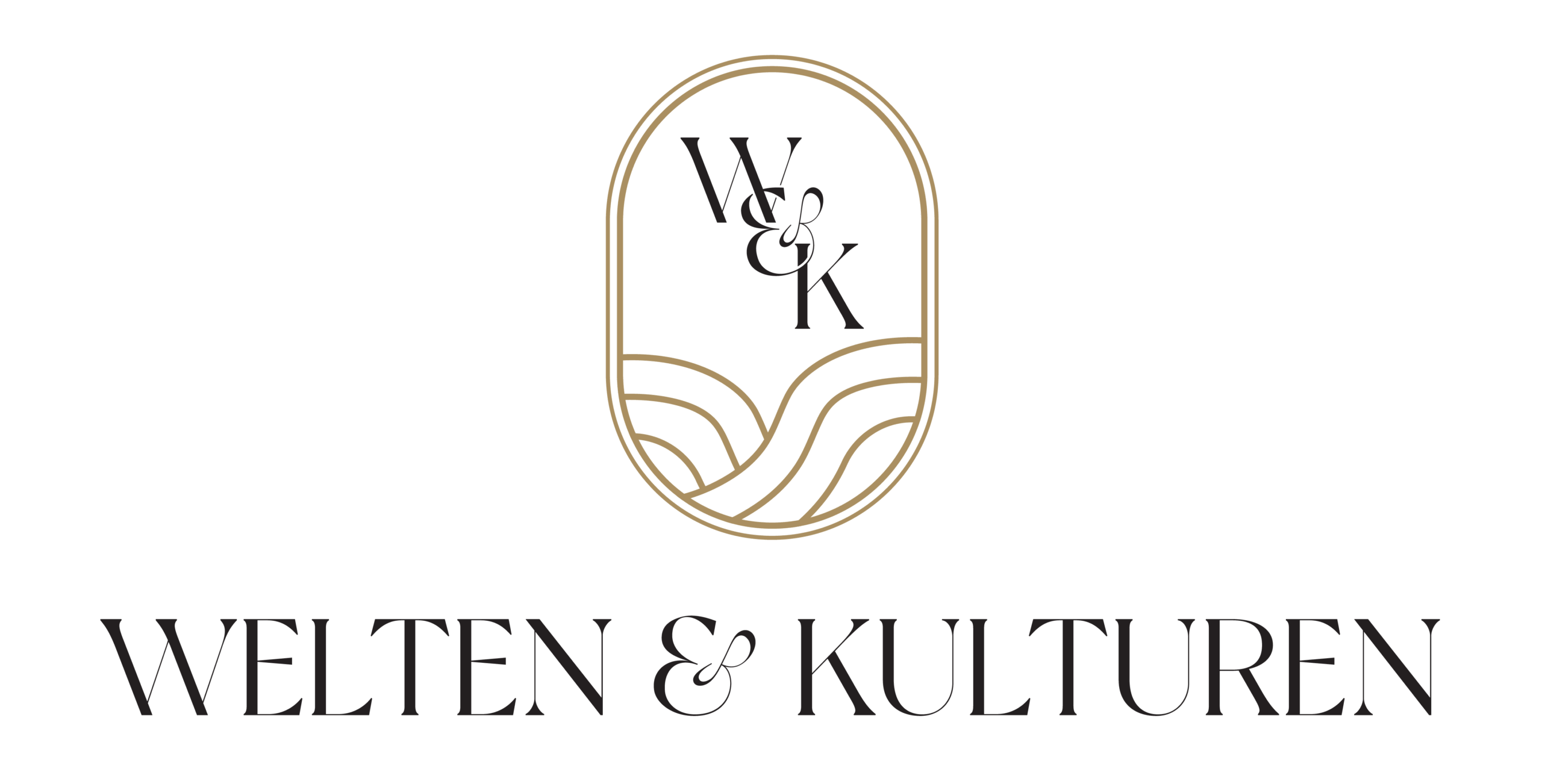Darkhan und Ulaanbaatar (2016)
Im Herbst 2016 reiste ich zum zweiten Mal in die Mongolei. Auch diesmal ging es nach Darkhan, wo ich an einer Universität einen Kurs in „Interkultureller Kompetenz“ unterrichten sollte. Geplant waren fünf Einheiten à 2 Stunden, was auch nach Plan umgesetzt werden konnte. Naja, irgendwie jedenfalls. Anschließend hatte ich die Möglichkeit, endlich auch die Hauptstadt des Landes etwas zu erkunden, was ich bei der ersten Reise 2014 versäumt hatte. Begonnen hat diese Reise aber vor allem kalt…
Begonnen hatte die Reise vor allem kalt.
Zwar war es erst Ende September, doch die Temperaturen in der ersten Woche lagen bereits bei -5 bis -11°C. An sich nicht so schlimm. Doch da war noch der bedauerliche Umstand, dass gleichzeitig die Heizung und die Warmwasserversorgung in dem Jugendzentrum, in dem ich untergebracht war, ausfielen. Auch das Internet funktionierte nur sporadisch. Umso glücklicher war ich, nachmittags für zwei Stunden in die Universität zu gehen, um zu unterrichten. Dort war es nämlich kuschelig warm.
Aber ich muss früher ansetzen mit der Erzählung. Hintergrund der Reise war ein neues Projekt, dass wir ins Leben gerufen hatten. Bei meinem letzten Aufenthalt hatte man mir nämlich mitgeteilt, dass an den Hochschulen der Stadt großes Interesse an Dozenten aus dem Ausland bestünde. Für Englisch, aber gerne auch in interkultureller Kommunikation.

Diese Information stammte von dem Leiter des Jugendzentrums in Darkhan, der mir dann den Kontakt eines Professors an der Hochschule gab. Und mit dem sprach ich dann das Seminar ab. Damals ahnte ich noch nicht, dass das der zweifellos abenteuerlichste der Lehraufträge meiner Laufbahn werden sollte.
Es sollte der zweifellos abenteuerlichste aller meiner Lehraufträge werden…
Denn also ich in Darkhan ankam, hatte mittlerweile der Leiter des Jugendzentrums gewechselt – was mit natürlich niemand mitgeteilt hatte. Er leitete nun eine Einrichtung in der Hauptstadt. Doch war ich nicht der einzig Ahnungslose: Auch der neue Leiter hatte keine Ahnung, wer ich war noch was ich dort tat. Glücklicherweise war er zumindest darüber unterrichtet worden, dass da irgendwer eintreffen würde. Nur das Ermitteln der richtigen Hochschule, an der ich ja nun unterrichten sollte, war etwas schwierig. Mit einigen Mühen fanden wir nach dem Ausschlussverfahren die wahrscheinlichste Institution.
In Begleitung eines etwa 13jährigen Mädchens, von der man sagte, dass sie am besten Englisch spräche, schickte man mich dann zur besagten Hochschule, von der, wie gesagt, noch unklar war, ob es eigentlich die richtige war. Dort sollte nun der Professor gesucht werden, mit dem ich korrespondiert hatte. Da ich mit ihm per E-Mail geschrieben hatte und die Antwortzeit stets mindestens eine, manchmal auch mehrere Wochen dauerte, hatte ich nämlich keine Zeit mehr, mich auf dieses Medium zu verlassen. Denn es war Montag und der erste Tag des geplanten Unterrichts. Meinen Kontakt fanden wir nicht; doch irgendeinen anderen Professor, der meinen Kontakt jedenfalls kannte und erklärte, dieser sei gerade abwesend. Auch er hatte keine Ahnung, wer ich war und was ich da sollte, aber jedenfalls dachte er sich offenbar, er müsse da jetzt irgendwas draus machen. Wie es zu dem ganzen Kuddelmuddel eigentlich gekommen war, ließ sich aufgrund der Sprachbarriere leider auch nicht herauszufinden. Ich nahm es also, wie es kam.
Beim Unterricht selbst musste ich entsprechend dezent improvisieren: Ich hatte nämlich darauf gezählt, Englischstudenten vor mir zu haben – so war die Absprache gewesen – , die zumindest größtenteils auch ohne Übersetzer verstehen würden, was ich vortrug und was die Aufgaben waren. Nun hatte man aber kurzerhand beschlossen, alle möglichen Studenten in den Kurs hineinzunehmen, also auch beispielsweise auch Ökonomie- oder Politologiestudenten.
Also, was eigentlich geschah, war Folgendes: Alle Studenten, die irgendwie gerade das Unglück hatten, auf dem Flur herumzustehen, wurden genötigt, sich in einen Klassenraum zu bewegen, in dem ich dann unterrichten sollte. Das war mein Publikum, das sich nun auf viel zu kleinen Stühlen an viel zu kleinen Tischen in einem kindgerecht dekorierten Raum drängte. Man muss nämlich dazu sagen, dass die Hochschule in einer ganz normalen Grund- und Mittelschule untergebracht war, in der vormittags Schule und nachmittags Universität stattfand. Nach demselben Rekrutierungsprinzip verfuhr man dann auch an den Folgetagen.
Nur sprach so gut wie keiner Englisch. Entsprechend war ich nun gänzlich auf den Einsatz eines Übersetzers angewiesen. In aller Eile mussten diverse Handouts auf Mongolisch übersetzt und ausgeteilt werden. Die PowerPoint-Präsentation, die ich den Studierenden zur Verfügung stellte, konnte allerdings nicht mehr übersetzt werden und war daher für viele Teilnehmer – vorsichtig formuliert – nicht so hilfreich, wie sie hätte sein können. Sagen wir: Was am Ende an Inhalt übrigblieb, wird auf ewig ein Rätsel bleiben.
Hinzu kam, dass jeden Tag andere Teilnehmer vor mir saßen, was das Konzept eines aufeinander aufbauenden Unterrichts dezent torpedierte. Aber sei’s drum, es wurde jedenfalls unterrichtet.
Hinzu kam, dass aufgrund der Rekrutierungsform jeden Tag andere Teilnehmer vor mir saßen, was das Konzept eines aufeinander aufbauenden Unterrichts dezent torpedierte. Aber sei’s drum, es wurde jedenfalls unterrichtet.
Die Interaktion war freilich, aus verschiedensten Gründen, limitiert. Wissen wollten die Teilnehmer aber zum Beispiel, wie die Deutschen das Thema Migration sehen. Denn auch wenn Außenstehenden die Mongolei nicht unbedingt als typisches Einwanderungsland bekannt ist, gibt es dort starke Migrationsströme, insbesondere von Chinesen, die zum Arbeiten in die Mongolei kommen – und bleiben. Umgekehrt zieht es viele Mongolen als Gastarbeiter nach Südkorea. Vor diesem Hintergrund interessierte die Studenten, ob die Probleme mit den Migranten wohl in Deutschland ähnlich seien? Denn die chinesischen Einwanderer sind, vorsichtig ausgedrückt, in der Mongolei nicht unbedingt beliebt. Man fürchtet den kulturellen Einfluss.
Ansonsten wollte jemand wissen, ob ich ein Pferd besäße. Als ich verneinte, schloss sich die entgeisterte Frage an, warum denn bloß nicht? Ich tat mein Bestes, den kulturellen Stellenwert des Pferdes und Reitens als Freizeitvergnügen der eher Betuchteren zu erläutern, denke aber angesichts der Fragezeichen in den Augen der Studenten, dass ich mich wohl als gescheitert betrachten muss.
Alles in allem war ohne Zweifel das interessanteste Seminar, den ich jemals durchgeführt habe. Auch wenn der Lernerfolg vermutlich überschaubar blieb.

Und ich möchte noch einmal erwähnen, dass es dort eine funktionierende Heizung gab. Ich hätte also gerne noch mehr unterrichtet, denn die Temperaturen sanken in der Woche auf bis zu -22°C, und Warmwasser gab es immer noch nicht. Das lag übrigens wohl daran – das behauptete jedenfalls der Leiter des Jugendzentrums –, dass man es seitens der lokalen Behörden nicht so gern sah, dass chinesische Christen dort missionierten. In der Folge sollen eingefrorene Rohre an dieser Stelle des Netzes immer als letztes freigelegt worden sein. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht.
Im Anschluss an meine Woche in Darkhan fuhr ich nach Ulaanbaatar (kurz: „UB“), wo ich in einem AirBnB unterkam.
Dort war es auch deutlich wärmer. Es gab auch deutlich mehr Smog, aber das war mir nach der Woche ohne Heizung und Warmwasser relativ egal. Wer sich allerdings in Deutschland über zu schlechte Luft beschwert, der möge wirklich mal zur rechten Jahreszeit nach UB reisen.
Die Stadt liegt einem Tal; da dort fast alle Haushalte mit Kohle heizen, bildet sich unter bestimmten Witterungsbedingungen eine wunderbare Kohleglocke über der ganzen Stadt. Diesem Geruch, der binnen kürzester Zeit Kopfschmerzen und Übelkeit verursacht, ist eigentlich kaum zu entgehen. Davon abgesehen ist Ulaanbaatar eine wirklich sehenswerte Stadt. Sogar der Vergnügungspark im Stadtzentrum hat seinen ganz eigenen Charme… wenn er auch nicht unbedingt Vertrauen einflößt.
Der monumentale Stil des Sukhbaatar Square ist vielleicht nicht jedermanns Ding – jedenfalls habe ich in einigen Reiseblogs böse Dinge darüber gelesen –, meines aber schon. Nun habe ich allerdings auch ganz allgemein eine Schwäche fürs Monumentale.

In unmittelbarer Nähe des zentralen Platzes mit dem Parlamentsgebäude und der Statue Khubilai Khaans liegt das kulturhistorische Museum (Монголын Үндэсний Музей), das für mich natürlich ein Muss war. Es ist kein besonders modernes Museum, sondern eher ein für den postsowjetischen Raum typisches kulturhistorisches Museum mit vielen nachgestellten Szenen und Einzelfiguren, die die Artefakte – meist Kleidung, Schmuck, Werkzeuge und anderes Gerät – quasi „in Aktion“ zeigen sollen. Als jemand, dem das Interaktive eigentlich eher zuwider ist, gefällt mir das eigentlich ganz gut. Denn wenn ich am Computer bloß Tasten drücken und mir Filmchen anschauen soll, kann ich das doch auch zuhause machen? Mittlerweile ist mein Besuch natürlich 7 Jahre her, also hat sich möglicherweise dort auch etwas verändert. In jedem Fall kann ich dieses größenmäßig überschaubare, aber im klassischen Sinne interessante Museum nur jedem ans Herz legen.

Als jemand, dessen erste Leidenschaft im Leben die Dinosaurier waren, ist die Mongolei als Fundregion für mich natürlich ein Mekka, ein Paradies. Für den Besuch des Schwarzmarktes, wo man allerlei echte und vor allem auch falsche Dinosaurierknochen erwerben können soll, gab es leider organisatorisch keine Möglichkeit; und Zeit für eine Reise in die Wüste Gobi war auch nicht. Daher wählte ich, um meine Dinosauerierleidenschaft wenigstens irgendwie zu ersatzbefriedigen, Plan C und ließ mich zur Hunnu Mall kutschieren. In diesem Einkaufszentrum sind nämlich mehrere Dinosaurierskelette ausgestellt und ganz umsonst zu bestaunen. Daher hatte diese Mall schon zwei Jahre zuvor eigentlich auf meiner Agenda gestanden. Obwohl für dortige Verhältnisse recht teuer, lohnt sich die Mall auch ansonsten: Unter anderem findet man dort sehr schöne und hochwertige Kaschmir-Waren.
Die mongolischen und meine Vorstellungen von „gutem Fleisch“ gehen leider auseinander.
Ich bin bekanntermaßen ein kulinarisch gänzlich uninteressierter Mensch. Wenn ich hier darauf hinweise, dass die mongolische Hauptstadt kulinarisch einiges zu bieten hat, so hat das einen konkreten Grund. Eigentlich gibt es nämlich in der Mongolei vor allem HotPot, was schmeckt, was man aber irgendwie auch nicht alleine essen geht, und natürlich die traditionelle mongolische Küche. Und die besteht vornehmlich aus Fleisch und dann in zweiter Linie aus …Fleisch. Womit ich im Prinzip kein Problem hätte, denn ich liebe Fleisch; nur gehen die mongolischen und meine Vorstellungen von „gutem Fleisch“ auseinander. Vieles wird aus stark fetthaltigem Fleisch hergestellt, das natürlich auch nahrhafter ist. Es ist also, von der traditionellen Küche her gedacht, eigentlich eine logische Wahl. Nur mag ich es eben nicht besonders. In Darkhan gab es davor für mich damals eigentlich kein Entrinnen. In Ulaanbaatar kann man aber, wenn man ein wenig mehr Geld in die Hand nimmt, wirklich eine gute Auswahl an exzellenten Restaurants verschiedener Küchen – insbesondere viele gute indische Restaurants – entdecken. Woran es in der Mongolei auch nie mangelt, ist russisches Eis. Das ist zweifellos das beste der Welt. Doch war mein Bedarf daran angesichts der Umstände, ohne Heizung und so, eher gering. Aber ansonsten ist das doch sehr beruhigend.
So konnte ich also 2016 endlich auch die Hauptstadt besser kennenlernen – nächstes Mal will dann der große, weite Rest des Landes erkundet werden…
Wie ich den Gorkhi Terelj National Park und den Chinggis Khaan Statue Complex, beides in der Nähe von Ulaanbaatar, besuchte, lesen Sie in dem Beitrag „Das Rattern der Transsib“, in dem ich über meinen Mongolei-Besuch 2014 berichte. Dort ist auch mehr über den eigentümlichen Charme der Stadt Darkhan zu lesen.